Veranstaltungsarchiv Villa Aurora
2016
Salon Sophie Charlotte 2016
Berlin
Leben wir wirklich in der „besten“ aller möglichen Welten? Und was heißt hier eigentlich „möglich“? Was fehlt, wenn alles bestens ist? Kommen wir ohne Utopien aus – politische, soziale, ökonomische oder ökologische? Was für Visionen haben Geflüchtete? Wie sind Gewalt und Terror vereinbar mit der Idee einer bestmöglichen Welt? Und was macht die beste aller möglichen Welten mit unserem Selbstverständnis? Gibt es ästhetische Rezepte für ein besseres Leben – für ein besseres Ich? Kann tatsächlich alles gut werden?
Über 100 Mitwirkende wagten beim „Salon Sophie Charlotte 2016“ Antworten auf diese Fragen: Astrophysiker, Kunsthistoriker und Menschenrechtstheoretiker, Schriftsteller, Filme macher und Musiker, Theologen, Mathematiker und Zukunftsforscher. Der Salon 2016 ist Gottfried Wilhelm Leibniz gewidmet. Er gründete – zusammen mit Kurfürstin Sophie Charlotte – um 1700 die Berliner Wissenschaftsakademie. Leibniz, der visionäre Denker, ermutigt uns bis heute zu Visionen. Er war es auch, der den Anstoß gab für die Frage nach der „besten aller möglichen Welten“.
Felicitas Hoppe hat eben eine Reise durch Amerika unternommen. Ihre Route war vorgegeben durch den Reisebericht des sowjetischen Schriftstellerduos Ilf und Petrow, die Mitte der 1930er Jahre, auf dem Höhepunkt des stalinistischen Terrors und der Great Depression, im Auftrag der Prawda eine viermonatige USA-Reise unternahmen. 70 Jahre später hat Felicitas Hoppe das literarisch-politische Klima der bipolaren Weltordnung neu überprüft.
Ihr Schriftstellerkollege Ingo Schulze, aufgewachsen in der DDR, reiste vor rund 20 Jahren in umgekehrter Richtung nach Russland, wo er einige Jahre lang eine Zeitung aufbaute. Im Gespräch vergleichen Sie ihre Erfahrungen mit dem Ost-West-Verhältnis im Wandel der Zeit: Zwei gegensätzlichen Imperien mit ihren jeweiligen Vorstellungen von einer besseren Welt.
Im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Ernst Osterkamp erörterten die beiden Schriftsteller vor rund 320 Zuschauern das Potenzial der ehemaligen UDSSR und der USA und als beste aller Welten.
Salon Sophie Charlotte 2016
Berlin


Leben wir wirklich in der „besten“ aller möglichen Welten? Und was heißt hier eigentlich „möglich“? Was fehlt, wenn alles bestens ist? Kommen wir ohne Utopien aus – politische, soziale, ökonomische oder ökologische? Was für Visionen haben Geflüchtete? Wie sind Gewalt und Terror vereinbar mit der Idee einer bestmöglichen Welt? Und was macht die beste aller möglichen Welten mit unserem Selbstverständnis? Gibt es ästhetische Rezepte für ein besseres Leben – für ein besseres Ich? Kann tatsächlich alles gut werden?
Über 100 Mitwirkende wagen beim „Salon Sophie Char lotte 2016“ Antworten auf diese Fragen: Astrophysiker, Kunsthistoriker und Menschenrechtstheoretiker, Schriftsteller, Filme macher und Musiker, Theologen, Mathematiker und Zukunftsforscher. Der Salon 2016 ist Gottfried Wilhelm Leibniz gewidmet. Er gründete – zusammen mit Kurfürstin Sophie Charlotte – um 1700 die Berliner Wissenschaftsakademie. Leibniz, der visionäre Denker, ermutigt uns bis heute zu Visionen. Er war es auch, der den Anstoß gab für die Frage nach der „besten aller möglichen Welten“.
In allen Räumen des Akademiegebäudes am Gendarmenmarkt werden an diesem Abend in künstlerisch-wissenschaftlichen Beiträgen alternative Welten verhandelt: Auch für Kinder und Jugendliche, für Liebhaber vergnüglicher Forschung und seriöser Wissenschaft, für Fans von Science Slams und Paternoster-Performances.
Imperien und bessere Welten
// 21.00 Uhr
// Felicitas Hoppe (Schriftstellerin, Stipendiatin der Villa Aurora)
// Ingo Schulze (Schriftsteller)
// Moderation: Ernst Osterkamp (Literaturwissenschaftler, HU Berlin, Akademiemitglied)
Felicitas Hoppe hat eben eine Reise durch Amerika unternommen. Ihre Route war vorgegeben durch den Reisebericht des sowjetischen Schriftstellerduos Ilf und Petrow, die Mitte der 1930er Jahre, auf dem Höhepunkt des stalinistischen Terrors und der Great Depression, im Auftrag der Prawda eine viermonatige USA-Reise unternahmen. 70 Jahre später hat Felicitas Hoppe das literarisch-politische Klima der bipolaren Weltordnung neu überprüft.
Ihr Schriftstellerkollege Ingo Schulze, aufgewachsen in der DDR, reiste vor rund 20 Jahren in umgekehrter Richtung nach Russland, wo er einige Jahre lang eine Zeitung aufbaute. Im Gespräch vergleichen Sie ihre Erfahrungen mit dem Ost-West-Verhältnis im Wandel der Zeit: Zwei gegensätzlichen Imperien mit ihren jeweiligen Vorstellungen von einer besseren Welt.
Eine Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Partnerschaft mit der Villa Aurora.
Lotus Eaters
Berlin
Lotus Eaters
Elif Erkan (*1985, Ankara) lebt und arbeitet in Los Angeles. Erkan ist eine Absolventin der HfBK Städelschule Frankfurt am Main, wo sie mit Willem de Rooij studierte. Ihre Arbeiten wurden international gezeigt, unter anderem am WIELS Centre d’art contemporain (Brüssel), am Portikus (Frankfurt am Main), an der Maison des Arts (Brussels) sowie der Villa Aurora (Los Angeles).
Lotus Eaters ist die erste Ausstellung der Galerie Weiss Berlin. Der Schwerpunkt der Galerie liegt in der Präsentation amerikanischer Gegenwartskunst. Die Galerie bietet Künstlern, vor allem aus Los Angeles und New York, die Möglichkeit zu Künstlerresidenzen in Berlin. Vertreten werden unter anderem die Künstler Elif Erkan, Alex Becerra, Evan Nesbit, Stanya Kahn, Eric Mack, Celeste Dupuy-Spencer, Buck Ellison, Allison Miller, und Keith Mayerson.
Lotus Eaters ist eine Kollaboration von Galerie Weiss Berlin und Villa Aurora.
// Elif Erkan, Lotus Eaters
// Eröffnung
// 30. Januar 2016
// 19 bis 21 Uhr
// Ausstellung: 4. Februar bis 26. März 2016
// Dienstag bis Samstag 11 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung
Los Angeles
Berlin


Berlin - L.A. Trilogy III
Marcel Buehler | Hans Diernberger
Veronika Kellndorfer | Anna McCarthy
Hans-Christian Schink | David Zink-Yi
// Ausstellungsdauer: 12. März bis 16. April 2016
// Öffnungszeiten: Di. bis Sa. 11 bis 18 Uhr
// Weitere Informationen: 68projects.com
Frauenrechte und Journalismus in Syrien
Berlin
Eine Kooperation von Reporter ohne Grenzen und Villa Aurora

Am 6. April 2016 fand in der Geschäftsstelle von Reporter ohne Grenzen fünf Jahre nach dem Beginn der Protestbewegung gegen das Assad-Regime in Syrien eine Veranstaltung zum Thema "Frauenrechte und Journalismus in Syrien" statt, die die Villa Aurora gemeinsam mit Reporter ohne Grenzen ausrichtete. Frauenrechte sind für Journalistinnen und Journalisten in Syrien seit langem ein heikles Terrain. In Teilen des Landes schränken extremistische islamische Gruppen die Bewegungsfreiheit von Frauen ein und verwehren ihnen den Zugang zu Bildung. Ihre äußerst restriktiven Vorstellungen von der Verteilung der Geschlechterrollen setzen sie mit massiver Gewalt durch. Für viele Frauen und Mädchen auf der Flucht gehören sexualisierte Gewalt, Prostitution und Zwangsheiraten zur traurigen Realität.
Auf dem Podium diskutierten Yasmin Merei, Journalistin und Menschenrechtsaktivistin, Chefredakteurin des Frauenmagazins Saiedet Souria, Yahya Alaous, Journalist und Menschenrechtsaktivist und Dina Aboul Hosn, Journalistin, Autorin und Übersetzerin, Mitbegründerin der Flüchtlingszeitung Abwab mit der Journalistin und Autorin Julia Gerlach über die Schwierigkeiten für Journalistinnen und Journalisten, die sich für mehr Frauenrechte in Syrien einsetzen.
Reporter ohne Grenzen und die Villa Aurora arbeiten bereits seit mehreren Jahren bei der Auswahl des Feuchtwanger Fellows zusammen. Dieses Fellowship vergibt die Villa Aurora in Zusammenarbeit mit der Feuchtwanger Memorial Library an der University of Southern California (USC) an Schriftstellerinnen und Schriftsteller oder Journalisten und Journalistinnen, die sich im Rahmen ihrer publizistischen Tätigkeit für die Wahrung der Menschenrechte engagieren oder in ihrer freien Meinungsäußerung beeinträchtigt sind. Mit diesem Stipendium, das einen Aufenthalt von bis zu neun Monaten in der Villa Aurora beinhaltet, erinnert der Verein an die Geschichte des Exils vieler Künstlerinnen und Intellektueller während des zweiten Weltkrieges und macht gleichzeitig auf die in vielen Teilen der Welt anhaltende Unterdrückung freier Meinungsäußerung aufmerksam.
Frauenrechte und Journalismus in Syrien
Berlin
Podiumsgespräch in englischer Sprache
Fünf Jahre nach dem Beginn der Protestbewegung gegen das Assad-Regime in Syrien laden Reporter ohne Grenzen und die Villa Aurora zu einem Podiumsgespräch mit
YASMINE MEREI, Journalistin und Menschenrechtsaktivistin, Chefredakteurin des Frauenmagazins Saiedet Souria
YAHYA ALAOUS, Journalist und Menschenrechtsaktivist
DINA ABOUL HOSN, Journalistin, Autorin und Übersetzerin, Mitbegründerin der Flüchtlingszeitung Abwab
Moderation: JULIA GERLACH, freie Journalistin und Autorin
Frauenrechte sind für Journalistinnen und Journalisten in Syrien seit langem ein heikles Terrain. In Teilen des Landes schränken extremistische islamische Gruppen heute die Bewegungsfreiheit von Frauen ein und verwehren ihnen den Zugang zu Bildung. Ihre äußerst restriktiven Vorstellungen von der Verteilung der Geschlechterrollen setzen sie mit massiver Gewalt durch. Für viele Frauen und Mädchen auf der Flucht gehören sexualisierte Gewalt, Prostitution und Zwangsheiraten zur traurigen Realität.
Auch das Assad-Regime hat sich zwar stets gerne als aufgeklärt und „moderat“ dargestellt, aber schon lange vor dem Beginn des Aufstands 2011 das Erstarken islamisch-konservativer Strömungen zugelassen und Journalistinnen und Journalisten bestraft, die allzu kritisch über Defizite bei den Frauenrechten berichteten.
Über die Schwierigkeiten für Journalistinnen und Journalisten, die sich für mehr Frauenrechte in Syrien einsetzen, berichten an diesem Abend:
YASMINE MEREI: Journalistin, Linguistin und Menschenrechtsaktivistin. Merei hat für verschiedene syrische Zeitungen geschrieben und war Mitherausgeberin der Magazine Al-Haqiqa und Suwar. Sie ist Chefredakteurin des Frauenmagazins Saiedet Souria (http://saiedetsouria.com) sowie Gründungsmitglied der Syrian Women's Lobby und Associate Director der Campaign Against Childhood Marriage. Von Juli bis Dezember 2015 war sie Feuchtwanger Fellow der Villa Aurora.
YAHYA ALAOUS saß wegen seiner kritischen Artikel über die Menschenrechtslage in Syrien von 2002 bis 2004 im Gefängnis. Nach seiner Entlassung wurden ihm die bürgerlichen und politischen Rechte aberkannt. Alaous schrieb dennoch weiter, insbesondere für Thara, ein digitales Untergrund-Wochenmagazin für Frauen- und Kinderrechte. Nach Beginn der Protestbewegung 2011 schrieb er unter Pseudonym für eine Oppositionszeitung, musste aber schließlich fliehen und lebt seit April 2015 in Berlin. Über sein Leben als Flüchtling schreibt er eine Kolumne in der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung.
DINA ABOUL HOSN ist Journalistin, Autorin und Übersetzerin und gehört zum Koordinationsausschuss der Syrian Feminist Lobby. Als Mitglied der verfolgten Minderheit der Drusen war sie ab dem Frühjahr 2011 zunehmenden staatlichen Repressalien ausgesetzt. Im Herbst 2012 ging sie deshalb nach Dubai und arbeitete dort für die Zeitung Gulf News. Durch die starke Präsenz syrischer Agenten wurde ihr Aufenthalt in Dubai so gefährlich, dass Aboul Hosn in Deutschland Asyl beantragte. Sie gehört zu den Gründern von Abwab, der ersten arabischsprachigen Zeitung für Flüchtlinge in Deutschland (https://issuu.com/abwab.de), und arbeitet als englischsprachige Redakteurin für die Website „I am a human story“ (http://iamahumanstory.com/en/).
JULIA GERLACH hat sieben Jahre lang als Korrespondentin mit Sitz in Kairo für deutschsprachige Medien wie die Berliner Zeitung, Focus, Cicero und die NZZ am Sonntag über die arabische Welt berichtet. Seit 2015 lebt sie in Berlin. Soeben ist im Ch. Links Verlag ihr Buch „Der verpasste Frühling. Woran die Arabellion gescheitert ist“ erschienen.
// Mittwoch, 6. April 2016 um 19:00 Uhr
// Geschäftsstelle von Reporter ohne Grenzen,
// Friedrichstraße 231 (2. HH, 3. Stock),10969 Berlin
// Anmeldung erbeten unter rog@reporter-ohne-grenzen.de
Weitere Informationen
Ausstellungseröffnung
Museum für Fotografie Berlin
M+M 7 Tage
Wir laden herzlich zur Eröffnung der Ausstellung M+M 7 Tage am Mittwoch, 27. April 2016, um 19 Uhr ein.
Moritz Wullen
Direktor der Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin
Museum für Fotografie
Staatliche Museen zu Berlin
Jebensstraße 2
10623 Berlin
Ausstellung
Museum für Fotografie Berlin
M+M 7 Tage
In einer eigens für den Fürstensaal des Museums für Fotografie konzipierten Installation präsentiert das Münchner Künstlerduo M+M den Filmzyklus 7 Tage. Es wird die komplette Reihe des siebenteiligen Werks gezeigt, das M+M sukzessive in einem Zeitraum von fast sieben Jahren entwickelt haben. Die Installation gleicht einem multiperspektivischen Kino, das die Sprache des Films um räumliche Strukturen und neue Erzählweisen erweitert. Jeder Film des Zyklus erzählt eine eigene Geschichte, die jedoch immer in zwei parallel projizierte Varianten gesplittet ist. Der Protagonist – dargestellt von dem Schauspieler Christoph Luser – sieht sich innerhalb der 7 Tage scheinbar alltäglichen, jedoch vollkommen gegensätzlichen Situationen ausgesetzt. Alle sieben Filme beziehen sich auf Schlüsselszenen aus unterschiedlichen Spielfilmen, in denen die psychologische Dimension zwischenmenschlicher Beziehungen zum Vorschein kommt. In ihren Doppelinszenierungen verleihen M+M diesen Szenen eine neue Lesart und entwickeln eine Filmsprache, die die Veränderlichkeit heutiger Identitäten zum Thema macht.
So reinszenieren M+M Szenen unter anderem aus Jean-Luc Godards Le mépris (1963), John Badhams Saturday Night Fever (1977) oder Stanley Kubricks The Shining (1980), wobei jeder Film einem Wochentag gewidmet ist. Zum Teil kehren von Film zu Film bestimmte Motive wieder, wie beispielsweise Beziehungen zwischen Vater, Mutter und Kind oder erotische Annäherungen oder Distanzierungen zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann. Bei jedem Film handelt es sich um eine präzise synchronisierte Doppelprojektion, in der bei exakt gleichem Dialog, Kameraführung und Schnitt eine Figur ausgetauscht ist. Die Stimmungen und die Bedeutungen der Dialoge und Handlungen verändern sich dabei teils unterschwellig, teils erheblich und offenbaren deren verstörenden Facettenreichtum. Ein zentrales Element der 7 Tage ist die Verteilung der Projektionsleinwände im Raum, die Zersplitterung des homogenen Filmraums und seiner Erzählstruktur zugunsten eines multiperspektivischen Kinos, das sich erst durch einen aktiven Betrachter erschließt, der Querbezüge zwischen den Projektionen, den multiplen Bildern und Geschichten herstellt. Die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Besonderheiten der Synchronerzählung, die M+M in den Filminstallation 7 Tage erproben, spiegelt ihr Interesse an den zunehmend komplexen Raum-, Identitäts- und Zeiterfahrungen unserer Gesellschaft.
M+M kombinieren in ihren konzeptionell ausgerichteten Werken oft verschiedene Medien, von Fotografie, Video und Film über Bildhauerei bis zu Architektur und Projekten im öffentlichen Raum. Seit einigen Jahren liegt der Fokus auf multimedialen Installationen.
Staatliche Museen zu Berlin
Jebensstraße 2
10623 Berlin
10 Euro, ermäßigt 5 Euro
Künstlergespräch
Museum für Fotografie Berlin
Künstlergespräch M+M 7 Tage
M+M im Gespräch
Museum für Fotografie
Staatliche Museen zu Berlin
Jebensstraße 2
10623 Berlin
Steine in Hitlers Fenster | Thomas Manns Radiosendungen Deutsche Hörer!
Berlin

Anlässlich des Jahrestages der Bücherverbrennung am 10 Mai. veranstalteten die Villa Aurora und das Literaturhaus Berlin einen Vortrag von der Dramaturgin und Autorin Dr. Sonja Valentin mit einer Lesung von Schauspieler und Sänger Gustav Peter Wöhler.
Vor einem zahlreich erschienenem Publikum las Gustav Peter Wöhler Texte von Thomas Mann, die in Zusammenhang mit der Bücherverbrennung stehen. Dr. Sonja Valentin analysierte auf Grundlage ihres Buchs Steine in Hitlers Fenster die Radiobotschaften im Kontext des Werks und der Lebensumstände von Thomas Mann.
Thomas Manns 58 Radiobotschaften, die von der BBC in den Jahren 1940 bis 1945 ausgestrahlt und auch in Deutschland zu hören waren, sind politisch engagierte Stellungnahmen zum Krieg und zu den Verbrechen der Nationalsozialisten. Sie bezeugen den Willen des Schriftstellers, aus seinem amerikanischen Exil gegen das zu protestieren, was unter der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland geschah und lösten anhaltende und oft feindselige Debatten aus.
Steine in Hitlers Fenster | Thomas Manns Radiosendungen Deutsche Hörer!
Berlin
Mit einer Lesung von Gustav Peter Wöhler und einem Vortrag von Dr. Sonja Valentin
Thomas Manns 58 Radiobotschaften, die von der BBC in den Jahren 1940 bis 1945 ausgestrahlt und auch in Deutschland zu hören waren, sind eine politisch engagierte Stellungnahme zum Krieg und zu den Verbrechen der Nationalsozialisten. Sie bezeugen den Willen des Schriftstellers, aus seinem amerikanischen Exil gegen das zu protestieren, was unter der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland geschah und lösten anhaltende und oft feindselige Debatten aus.
Am 25. Mai 1943 nahm Thomas Mann den 10. Jahrestag der Bücherverbrennung zum Anlass für eine besonders eindringliche Deutsche Hörer!-Ansprache:
„Es ist merkwürdig genug, daß unter allen Schandtaten des Nationalsozialismus, die sich in so langer, blutiger Kette daranreihten, diese blödsinnige Feierlichkeit der Welt am meisten Eindruck gemacht hat und wahrscheinlich am allerlängsten im Gedächtnis der Menschen fortleben wird. Das Hitler-Regime ist das Regime der Bücherverbrennungen und wird es bleiben.“ (Thomas Mann)
Gustav Peter Wöhler, Schauspieler und Sänger, liest Texte von Thomas Mann, die in Zusammenhang mit der Bücherverbrennung stehen.
Dr. Sonja Valentin, Dramaturgin und Autorin, analysiert auf Basis ihres Buchs Steine in Hitlers Fenster die Radiobotschaften im Kontext des Werks und der Lebensumstände von Thomas Mann.
Literaturhaus Berlin
Fasanenstraße 23, 10719 Berlin
Eintritt frei
Villa Aurora Nacht
Berlin
Empfang

Rund 400 Gäste aus Kultur, Politik und Medien kamen am Montagabend in das Museum für Fotografie am Bahnhof Zoo um die Villa Aurora Nacht zu feiern. In diesem Jahr fand die Veranstaltung in Kooperation mit der Alfred Herrhausen Gesellschaft und der Kunstbibliothek – Staatliche Museen zu Berlin statt.
Nach der Begrüßung durch den Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Prof. Dr. Michael Eissenhauer, in der auch die geplante transatlantische Ausstellung "Renaissance und Reformation: Kunst im Zeitalter der Reformation" vorgestellt wurde, hielt John B. Emerson, US-Botschafter in Deutschland, eine Ansprache, in der er sich unter anderem zu den aktuellen Entwicklungen im US-Wahlkampf äußerte. Dr. Sigrid Bias-Engels, Gruppenleiterin bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, stellte die Aktivitäten rund um das bevorstehende Lutherprojekt in Deutschland dar und Dr. Andreas Görgens, Leiter der Abteilung Kultur und Kommunikation des Auswärtigen Amts, erläutert dessen Engagement für die transatlantischen Lutherprojekte im Jahr 2017.
Der Historiker Professor Heinrich August Winkler und Tagesspiegelredakteur Dr. Christoph von Marschall diskutierten anlässlich der Wahlkampf-Entwicklungen die Auswirkungen für die Zukunft der USA-Europa-Beziehungen.
Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte das Künstlerduo M+M ihre aktuelle Ausstellung im Museum für Fotografie „7 Tage“ und Villa Fellow Udo Moll führte seine Performance "Selectron Souls" auf, die in der Villa Aurora entstanden ist.
Zur Fotogalerie
zerfall_gebiete
Berlin
Konzert

klänge zerfallen
re-gruppieren konglomerate
implodieren zu staub
driften auseinander
atmende brüchig graue texturen
Mitte Juni fand bei SPEKTRUM art_technology_community in Neukölln vor rund 80 Zuschauern ein Konzert des Duos 'zerfall_gebiete' statt. 'zerfall_gebiete' - das sind: Die Villa Aurora Fellows Thomas Köner, Medienkünstler in den Bereichen Komposition, bildende Kunst, Installation und Musikproduktion, und Ulrich Krieger, bekannt als Saxophonist in der zeitgenössischen komponierten und frei improvisierte Musik sowie als Komponist von Kammermusik und elektronischer Musik.
Gemeinsam verbinden sie die weichen, akustischen und quasi-elektronischen Klänge von Kriegers Saxophon mit der ausgeklügelten Elektronik von Koener.
Alles wird eins: das Instrument klingt elektronisch, die elektronischen Klänge nach Instrumenten - zuletzt ist es unwichtig, wer was gespielt hat. Die verschiedenen Felder verschmelzen zu einer einzigen, komplexen Klang-Landschaft, die gemeinsam mit den Visuals ein allumfassendes Erlebnis wird. Dark Ambient-Drohnen, subtile Geräusche, langsame Entwicklung sinnliche Texturen und die gelegentliche Andeutung einer Melodie.
zerfall_gebiete
Berlin
Thomas Köner & Ulrich Krieger
zerfall_gebiete
klänge zerfallen
re-gruppieren konglomerate
implodieren zu staub
driften auseinander
atmende brüchig graue texturen
Das Duo 'zerfall_gebiete' verbindet die weichen, akustischen und erweiterte quasi-elektronischen Klängen von Kriegers Saxophon mit den ausgeklügelten Elektronik von Koener: das Instrument klingt elektronisch, die elektronischen Klänge nach Instrumenten und zuletzt ist es unwichtig, wer was getan hat, alle wird eins. Die verschiedenen Felder verschmelzen zu einer einzigen, komplexen Klang-Landschaft, die gemeinsam mit den Visuals ein allumfassendes Erlebnis wird. Dark Ambient-Drohnen, subtile Geräusche, langsame Entwicklung sinnliche Texturen und die gelegentliche Andeutung einer Melodie.
Thomas Köner arbeitet als Medienkünstler in den Bereichen Komposition, bildende Kunst, Installation und Musikproduktion.
Ulrich Krieger ist als Saxophonist in der zeitgenössischen komponierten und frei improvisierte Musik bekannt. Auch als als Komponist von Kammermusik und elektronischer Musik hat sich Ulrich Krieger einen Namen gemacht.
Location
SPEKTRUM | art science community
Bürknerstraße 12, 12047 Berlin
Tickets
5 bis 10 Euro (nach Belieben)
Rosha Yagmai: Waxworks
Berlin
Rosha Yaghmai
In der ersten Ausstellung der Bildhauerin mit der Galerie Weiss Berlin wird Yaghmais fortlaufende, intensive Auseinandersetzung mit Materialen, Fertigungsverfahren, Formen und Farben deutlich, die in der Tradition amerikanischer, im Besonderen moderner kalifornischer Skulptur steht. Die neue Werkgruppe umfasst unter anderem Objekte aus Silikon, Fiberglas, Kalkstein und gefundenen Gegenständen, die alle luminös, zum Teil transparent oder opak erscheinen.
Die präzisen, aus Silikon gegossenen farbigen Panels wirken undurchdringlich, fest und schwer. Jede Tafel schließt eine Art Verbindungselement wie einen Schlauch für Wasserpfeifen, Taucher, Duschen oder aber ein Kabel ein. Sie wirken wie fossilisierte Relikte aus längst vergangenen Zeiten: Ihre Durchlässigkeit, einst das wichtigste Merkmal ihrer Funktionalität, ist für immer blockiert.
Rosha Yaghmai lebt in Los Angeles und war der zweite Berlin Fellow der Villa Aurora bei Weiss Berlin.
Waxworks
Berlin
Rosha Yaghmai
Die Villa Aurora vergibt einmal im Jahr ein Berlin Fellowship an eine Künstlerin oder einen Künstler aus Los Angeles. Partner im Jahr 2016 ist erneut die Galerie Weiss Berlin, deren Schwerpunkt in der Präsentation amerikanischer Gegenwartskunst liegt. Frühere Partner waren das Zentrum für Kunst und Urbanistik ZK/U und die Residenz Torstraße 111.
Rosha Yaghmai lebt und arbeitet in Los Angeles. Sie schloss ihr Studium bei CalArts im Jahr 2007 mit einem MFA ab und war Fellow der Terra Foundation im Jahr 2009. Ihre bevorstehenden Solo-Projekte finden unter anderem bei Weiss Berlin und Kleopatra, New York statt. Außerdem wird sie an der Ausstellung Knowledge im Mount Wilson Observatory in Los Angeles teilnehmen. Ihre Arbeiten wurden in verschiedenen Ausstellungsräumen, einschließlich Public Fiction, Los Angeles; Commonwealth & Council, Los Angeles; GBK, Sydney; Kayne Griffin Corcoran, Los Angeles; Thomas Solomon Gallery, Los Angeles; Riverside Art Museum; LACE, LAX><ART, Estacion Tijuana; and Transmission Gallery, Glasgow, ausgestellt.
Eröffnung: Freitag, 8. Juli 2016, 19.00 bis 21.00 Uhr
Ausstellung: 9. Juli bis 6. August 2016, Donnerstag bis Samstag 13.00 bis 18.00 Uhr und nach Vereinbarung, +49 (0)30 23 91 95 60, info@weissberlin.com
Galerie Weiss Berlin
Bundesallee 221, 10719 Berlin
Jan Brandt: Stadt ohne Engel
Berlin
Buchpremiere
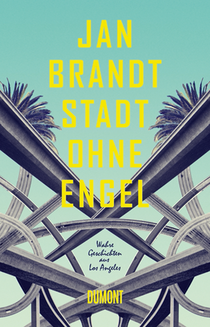
Stadt ohne Engel
Im Jahr 2014 reist der Schriftsteller Jan Brandt zu einem Stipendium in der Villa Aurora nach Los Angeles, der „Stadt der Engel“. In dieser Zeit ergründet er erfüllte und unerfüllte Sehnsüchte und bringt in seinem Buch STADT OHNE ENGEL den schillernden Kosmos auf unerhörte Weise zum Sprechen.
Im Oktober lud die Villa Aurora gemeinsam mit dem me Collectors Room und DuMont Buchverlag zur Buchpremiere ein; einer Einladung, der rund 100 interessierte Zuschauer folgten. Moderiert wurde der Abend von dem Schriftsteller und ehemaligen Villa Aurora-Stipendiaten Florian Werner.
Jan Brandt erzählt in seinem Buch von Menschen, denen er auf Streifzügen begegnet ist: von Neohippies bis zum Starkoch, vom Start-up-Unternehmer und einer jungen Auftragsdichterin bis zum Gangsta-Rapper. Es sind Geschichten von Glücksrittern, die versuchen, trotz aller Widerstände den amerikanischen Traum zu leben. In STADT OHNE ENGEL (DuMont 2016) verbinden sich literarische Reportagen mit Essays, persönliche Begegnungen und Beobachtungen mit Zeitungsartikeln. Twitter-Meldungen und Facebook-Nachrichten verschmelzen zu einem kollektiven urbanen Rauschen. Es ist ein Buch über die pulsierende Stadt Los Angeles, die „vielleicht wahnsinnigste Metropole der Welt“.

Jan Brandt, geboren 1974 in Leer (Ostfriesland), studierte Geschichte und Literaturwissenschaft in Köln, London und Berlin und besuchte die Deutsche Journalistenschule in München. Sein Roman GEGEN DIE WELT (DuMont 2011) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und wurde mit dem Nicolas-Born-Debütpreis ausgezeichnet. Zuletzt erschien TOD IN TURIN (DuMont 2015).
Jan Brandt
Berlin
Buchpremiere
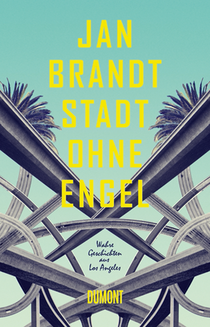
Stadt ohne Engel
Im Jahr 2014 reist der Schriftsteller Jan Brandt zu einem Stipendium in der Villa Aurora nach Los Angeles, der „Stadt der Engel“. In dieser Zeit ergründet er erfüllte und unerfüllte Sehnsüchte und bringt in seinem Buch STADT OHNE ENGEL den schillernden Kosmos auf unerhörte Weise zum Sprechen.
Jan Brandt erzählt in seinem Buch von Menschen, denen er auf Streifzügen begegnet ist: von Neohippies bis zum Starkoch, vom Start-up-Unternehmer und einer jungen Auftragsdichterin bis zum Gangsta-Rapper. Es sind Geschichten von Glücksrittern, die versuchen, trotz aller Widerstände den amerikanischen Traum zu leben. In STADT OHNE ENGEL (DuMont 2016) verbinden sich literarische Reportagen mit Essays, persönliche Begegnungen und Beobachtungen mit Zeitungsartikeln. Twitter-Meldungen und Facebook-Nachrichten verschmelzen zu einem kollektiven urbanen Rauschen. Es ist ein Buch über die pulsierende Stadt Los Angeles, die „vielleicht wahnsinnigste Metropole der Welt“.
Zur Buchpremiere am 13. Oktober 2016 lädt die Villa Aurora gemeinsam mit dem me Collectors Room und DuMont Buchverlag um 19 Uhr ein. Moderiert wird der Abend von dem Schriftsteller und ehemaligen Villa Aurora-Stipendiaten Florian Werner.

Jan Brandt, geboren 1974 in Leer (Ostfriesland), studierte Geschichte und Literaturwissenschaft in Köln, London und Berlin und besuchte die Deutsche Journalistenschule in München. Sein Roman GEGEN DIE WELT (DuMont 2011) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und wurde mit dem Nicolas-Born-Debütpreis ausgezeichnet. Zuletzt erschien TOD IN TURIN (DuMont 2015).
Eintritt: € 7,- / 4,-
Anmeldung erbeten unter info@me-berlin.com
Donnerstag, 13. Oktober 2016, 19 Uhr
me Collectors Room Berlin, Auguststraße 68, 10117 Berlin
Zum Facebook-Event
Manfred Flügge
Berlin
Flucht aus Frankreich

Die amerikanischen Retter von Lion und Marta Feuchtwanger
Auf einer abenteuerlichen Flucht entkommen der deutsch-jüdische Schriftsteller Lion Feuchtwanger und seine Frau Marta im Herbst 1940 aus dem von deutschen Truppen besetzten Frankreich in die USA. Nur mit Hilfe ihrer amerikanischen Retter Varian Fry, Hiram Bingham sowie Martha und Waitstill H. Sharp konnte das gelingen. Sie haben Vorschriften gebrochen, ihre Stellung und ihr Leben riskiert und durch ihr mutiges Handeln vielen Menschen im Frankreich der 1930er und 40er Jahre das Leben gerettet.
Für die Villa Aurora, die Marta und Lion Feuchtwanger seinerzeit als Exildomizil diente und später als Künstlerresidenz eröffnet wurde, hat Manfred Flügge, Autor und ehemaliger Stipendiat in der Villa Aurora, die Geschichte der Flucht von Marta und Lion Feuchtwanger in einer zweisprachigen Publikation nachgezeichnet. Am Dienstag, dem 6. Dezember 2016 um 20 Uhr, wird Manfred Flügge im Literaturhaus in der Fasanenstraße in Berlin das Buch in einem Vortrag mit Bildern und Filmausschnitten vorstellen.

Manfred Flügge wurde 1946 geboren. Er wuchs im Ruhrgebiet auf, studierte Romanistik und Geschichte in Münster und in Lille. Von 1976 bis 1988 war er Dozent an der Freien Universität Berlin. Manfred Flügge lebt als freier Autor in Berlin.
Zusammen mit dem Literaturhaus Berlin
Eintritt: 5 / 3 Euro
Ort: Literaturhaus Berlin, Fasanenstraße 23, 10719 Berlin
Oswald Egger: Harlekinsmäntel und andere Bewandtnisse
Berlin
Harlekinsmäntel und andere Bewandtnisse

mit Oswald Egger und Günter M. Ziegler
Am Abend des 9. Dezember luden die Villa Aurora, die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und der Verlag Matthes & Seitz Berlin zur Buchpremiere von Oswald Eggers Buch „Harlekinsmäntel und andere Bewandtnisse“ ein. In einer amüsanten Tour-de-force durchstreiften Eggers und der Moderator, der Mathematiker Prof. Günter M. Ziegler, die Leibnizsche Gedankenwelt.
In seiner poetologischen Untersuchung versucht Egger einige Aspekte der verschwiegeneren Ideen und implizit gedachten Verbindungs- und Beziehungslinien im Werk Leibniz‘ zusammenzureimen. Seine unorthodoxe Lesart von Regeln und Ergebnissen der Physik, Metaphysik und Mathematik bilden einen Bewandtniszusammenhang aus inneren Verwandtschaftsbeziehungen – oft auch ohne offenkundige Verknüpfung. Anschauliche Modelle und Gedankenexperimente bringen dabei unentwegt zur Sprache, „wie eins zum anderen kommt“. In Form von Worten und Formen ohne Worte illustriert Oswald Egger anhand einiger Motive bei Leibniz Zusammenhänge, die ihn „oft selbst überraschen“. Im „poetischen Tun“ überschneiden sich Dunkles und Verworrenes einleuchtend in einem Geflecht aus Evidenzen.
„Harlekinsmäntel und andere Bewandtnisse“ erscheint bei Matthes & Seitz Berlin.
Prof. Oswald Egger, geboren 1963 in Lana, Südtirol, studierte Literatur und Philosophie und lebt heute in Wien. Er war Herausgeber der Zeitschriften Der Prokurist und per procura und veranstaltete die Kulturtage Lana. Zahlreiche Gedichte wurden übersetzt, unter anderem ins Amerikanische, Französische und Niederländische. 2007 erhielt er den Peter-Huchel-Preis, 2008 den H.C. Artmann-Preis, dem 2010 der Oskar Pastior-Preis folgte. 2001 erhielt er ein Stipendium in der Villa Aurora, Los Angeles, 2014 den outstanding artist award für Literatur und das Stipendium der Villa Massimo in Rom. Seit 2011 ist er Inhaber der neu geschaffenen Professur „Sprache und Gestalt“ an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel.
Prof. Günter M. Ziegler, ebenfalls Jahrgang 1963, ist geborener Münchner und Mathematiker. Seit März 2011 forscht und lehrt er an der FU Berlin. Seine Arbeit beschäftigt sich unter anderem mit der Theorie der Polyeder. Dafür wurde er 2001 mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der DFG ausgezeichnet. Seinen ersten (und einzigen) Literaturpreis erhielt er 1993 für „Fragmente einer Legende“. Mit Martin Aigner schrieb er „Das BUCH der Beweise“, das inzwischen in vierzehn verschiedenen Sprachen vorliegt. 2009 erschien „Darf ich Zahlen? Geschichten aus der Mathematik“ bei Piper (München) und 2013 „Mathematik - Das ist doch keine Kunst!“ (Knaus, München). Er ist Mitglied des Vorstands und Sprecher des Jahresthemas 2015|16 „Leibniz: Vision als Aufgabe“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Eine Veranstaltung der Villa Aurora in Kooperation mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Matthes und Seitz Berlin im Kontext des Jahresthemas





